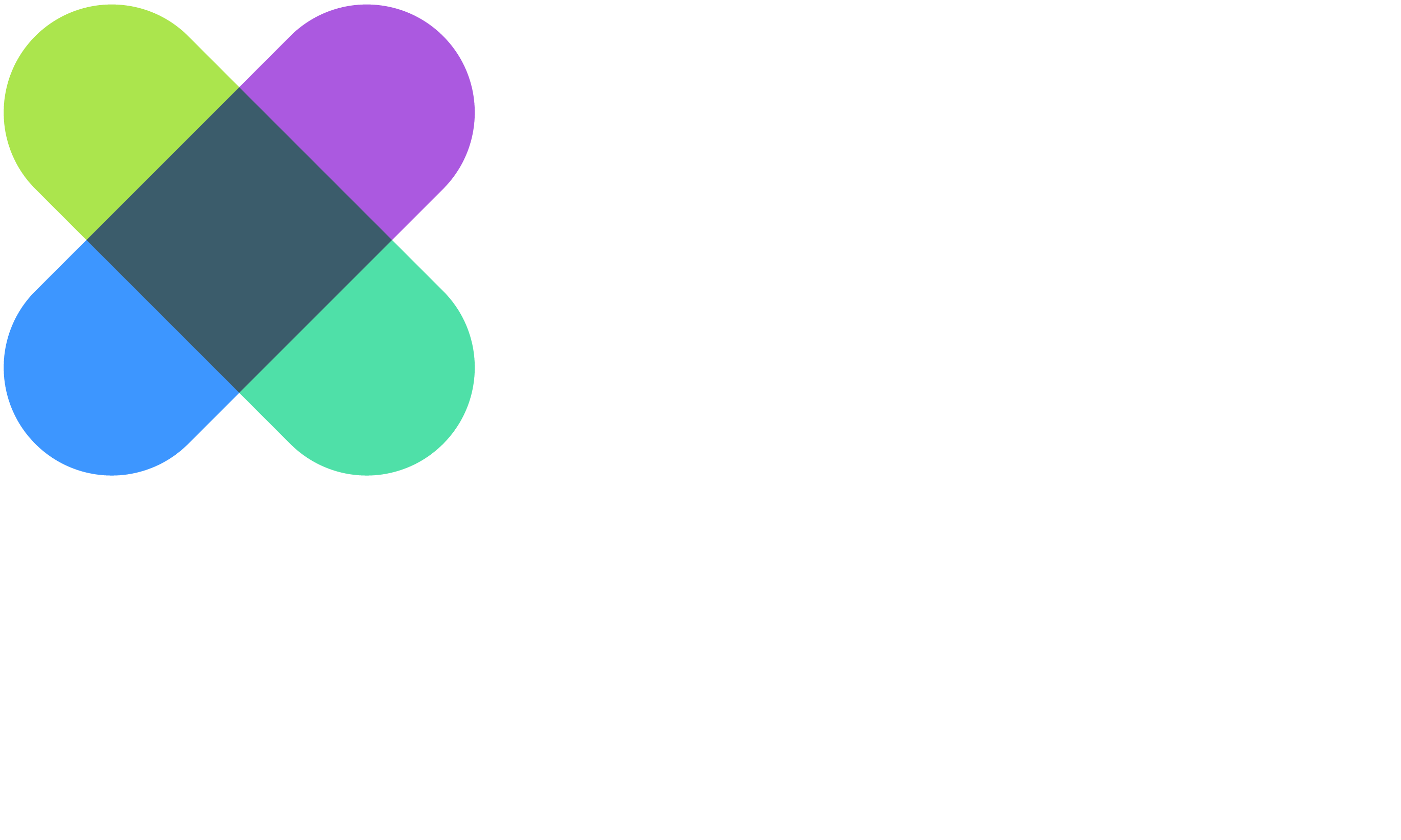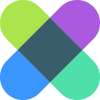Alles zum digitalen Gewaltschutzgesetz
Gesetzesinitiative zum Schutz vor digitaler Gewalt
Die Bundesregierung kündigte in ihrem Koalitionsvertrag 2021 ein Gesetz gegen digitale Gewalt an. Ziel des Gesetzes soll sein, dass Betroffene vor Gericht einfacher gegen digitale Gewalt vorgehen können. HateAid brachte ihre Expertise zum ersten Eckpunktepapier des Gesetzes ein, zum Beispiel in Fachgesprächen und Stellungnahmen, und holte ein Gutachten ein.
Im Dezember 2024 präsentierte das Bundesministerium der Justiz einen Gesetzesentwurf, der vor der Bundestagswahl jedoch nicht mehr in den Bundestag eingebracht wird. HateAid fordert den zukünftigen Gesetzgeber auf, den Entwurf nachzubessern und das Gesetz zügig zu verabschieden.
Hintergrund der Gesetzesinitiative
Darum braucht es ein neues Gesetz
Digitale Gewalt ist allgegenwärtig: Fast jede zweite Person wurde schon einmal online beleidigt. Betroffene fühlen sich häufig allein gelassen.
Auch das europäische Digitalgesetz, der Digital Services Act, hat daran kaum etwas geändert. Denn dieses befasst sich vor allem mit der Haftung von Online-Plattformen.
Die Bundesregierung muss zusätzlich dafür sorgen, dass Nutzende ihre Rechte auch vor Gericht wahrnehmen können – und zwar unter zumutbaren Bedingungen. Das ist bisher nicht der Fall. Stattdessen werden Betroffene durch lange Verfahrenslaufzeiten, hohe Kosten und niedrige Erfolgschancen davon abgehalten, vor Gericht zu gehen.

Weil sich der europäische DSA auf die Haftung von Plattformen fokussiert, sollen auf Bundesebene die Betroffenenrechte gestärkt werden. Foto: Shutterstock
Petition „Gerechtigkeit im Netz: #StopHateMakeLaws“
Wer sich gegen Hass und Gewalt im Netz wehrt, kommt oft nicht weit. Denn Gerichtsverfahren sind teuer und dauern viel zu lange. Gerechtigkeit im Internet sieht anders aus! Deswegen fordern wir mit einer Petition jetzt mehr Gerechtigkeit für Betroffene von digitaler Gewalt.
Mit dem Gesetz gegen digitale Gewalt möchte die Bundesregierung vor allem die individuelle Rechtsdurchsetzung stärken. Dafür sollen laut Bundesministerium neue Möglichkeiten geschaffen werden:
- Es sollen Lücken bei den Auskunftsrechten abgebaut werden. Denn bisherige Möglichkeiten, an die Daten der Account-Inhaber*innen zu gelangen, funktionieren nicht. Hierfür soll der Auskunftsanspruch gegen soziale Netzwerke und Messenger-Dienste neu geregelt werden.
- Es soll künftig für Betroffene möglich sein, vor Gericht die Sperrung von Accounts zu erwirken, von denen sie mehrfach in schwerer Weise angegriffen wurden.
Unsere Forderungen an die künftige Bundesregierung
Gesetzentwurf nachbessern und verabschieden
Im Dezember 2024 legte das BMJ einen Gesetzentwurf zum Gesetz gegen digitale Gewalt vor – erst 1,5 Jahre nach dem Eckpunktepapier. HateAid wird sich auch diesmal wieder intensiv in die Debatte zu dem Gesetzentwurf einbringen.
HateAid sieht u. a. in folgenden Punkten Nachbesserungsbedarf:
Betroffene müssen in der Zukunft realistisch in der Lage sein, die Identität der Täter*innen zu ermitteln, um gerichtlich gegen sie vorgehen zu können. Der Gesetzgeber muss es Betroffenen daher ermöglichen, mit nur einem einzigen Verfahren – sowohl bei sozialen Netzwerken als auch bei Internetzugangsdiensten – an die notwendigen Daten zu gelangen. Hier enthält der Entwurf gute Ansätze.
HateAid fordert außerdem, die Kosten des Auskunftsverfahrens zu senken. Sinnvoll wäre etwa, einen festen Gegenstandswert für ein solches Verfahren festzulegen, damit Betroffene nicht, so wie aktuell der Fall, von den Kosten abgeschreckt werden.
HateAid bezweifelt, dass Account-Sperren über den Einzelfall hinaus wirklich massentauglich und für Betroffene praktikabel sind. Die Umgehungsgefahr ist auch mit den im Entwurf vorgesehenen Regelungen noch sehr hoch. Täter*innen können sich z. B. leicht eine neue E-Mail-Adresse und darüber neue Accounts anlegen.
Hilfreich wäre außerdem, wenn nicht die Betroffenen, sondern z. B. die Aufsichtsbehörden dafür verantwortlich wären, Anträge auf Account-Sperren bei Gericht einzureichen. Grundsätzlich positiv zu bewerten ist, dass NGOs die Möglichkeit haben sollen, Anträge auf Account-Sperren zu stellen. Dafür müssten sie jedoch mit den nötigen Ressourcen ausgestattet werden.
Die strafrechtliche Verfolgung digitaler Gewalt muss vereinfacht werden. HateAid fordert ein bundesweit einheitliches digitales Anzeigeverfahren, damit Betroffene jegliche digitale Gewalt strafrechtlich zur Anzeige bringen können – auch Beleidigungen, Verleumdungen und Bildrechtsverletzungen.
Und: Die Verbreitung gefälschter Nacktaufnahmen darf nicht länger als Bagatelldelikt behandelt werden, sondern der Gesetzgeber muss einen eigenen Straftatbestand dafür schaffen, der auch die Herstellung von nicht einvernehmlich erstellten sexualisierten Deepfakes erfasst. Die psychischen Folgen für Betroffene sind zu gravierend.
Comic an den Bundestag: Betroffene stärken, Hürden abbauen
Damit unsere Forderungen für die Menschenrechte im Netz nicht in den vollen Postfächern der Bundestagsabgeordneten untergehen, haben wir uns etwas Besonderes ausgedacht: Unser Appell an die Politik kommt als bunte Geschichte. In einem Comic machen wir die unerträglichen Erfahrungen von Betroffenen nachvollziehbar und fordern die Politik zum Handeln auf.
Wie wir das Gesetz mitgestalten
HateAid setzt sich für dich ein
Ob durch offizielle Stellungnahmen oder mit einer Aktion vor dem Bundestag: Wir bringen konkrete Vorschläge zum angekündigten Gesetz ein.
Mit unserer Kampagne #StopHateMakeLaws machten wir auf die Hürden aufmerksam, vor denen Betroffene stehen, wenn sie sich gegen digitale Gewalt wehren wollen – mit einem Hürdenlauf vor dem Bundestag.
Auch in allen weiteren Schritten des Gesetzgebungsprozesses werden wir unsere Forderungen für einen besseren Schutz vor digitaler Gewalt einbringen. Dafür suchen wir das Gespräch mit Abgeordneten und Vertreter*innen der Ministerien. Jetzt braucht es aber den nächsten Schritt: Den Gesetzentwurf, den das Bundesjustizministerium dringend vorlegen muss.
Speichere dir diese Seite in deinen Lesezeichen oder abonniere unseren Newsletter, um zu erfahren, wie es mit dem Gesetz weitergeht.

Das „Gesetz gegen digitale Gewalt“ wird von uns mit Aktionen begleitet. Foto: HateAid
Häufige Fragen zum angekündigten Gesetz
FAQ
Das Auskunftsverfahren sieht vor, dass Betroffene einen gerichtlichen Antrag auf die Herausgabe einer IP-Adresse wegen einer schweren Persönlichkeitsrechtsverletzung stellen können. Da die Internetzugangsdienste die IP-Adresse nur wenige Tage speichern und ein Gerichtsverfahren meistens länger dauert, müssen die Gericht im Eilverfahren anordnen können, dass die Anschlussinhaber*innendaten nicht gelöscht werden, bis das Gericht endgültig entschieden hat.
Die Herausgabe der IP-Adresse wird beim sozialen Netzwerk angefragt, das die IP-Adressen immer auf unbestimmte Zeit behält. Vorratsdatenspeicherung bezeichnet die anlasslose Speicherung von Daten. Die Daten werden aber nur herausgegeben, wenn das Gericht eine schwere Rechtsverletzung als Anlass feststellt. Damit braucht es für das Auskunftsverfahren also keine Vorratsdatenspeicherung. Diese ist auch an keiner Stelle des Eckpunktepapiers vorgesehen: Eine allgemeine zusätzliche Speicherpflicht für soziale Netzwerke oder Messenger-Dienste ist dort nicht geplant.
Das Auskunftsverfahren ist ein wichtiger Schritt, um Täter*innen digitaler Straftaten ausfindig zu machen. Aber die IP-Adresse ist erstmal nur eine Zahlenfolge. Sie muss dann mit den Anschlussinhaberdaten beim Internetprovider zusammengeführt werden, um nützlich zu sein. Dort ist die Speicherdauer sehr kurz, weswegen das Gesetz eine anlassbezogene Sicherungsanordnung vorsieht.
Alle Menschen sollten die Möglichkeit haben, sich im Netz frei und anonym zu bewegen. Keine Person sollte gezwungen werden, öffentlich z. B. mit Klarnamen aufzutreten oder den Personalausweis vorlegen zu müssen, wenn sie sich ein Konto in sozialen Medien anlegen will.
Es kann jedoch keinen Anspruch auf absolute Anonymität geben, wenn die Rechte anderer verletzt werden. Wenn sich nämlich einige wenige die Freiheit herausnehmen, digitale Gewalt zu verbreiten, schränkt dies die Freiheit der Betroffenen ein – und die der Mitlesenden, die sich künftig nicht mehr trauen, sich äußern. Es muss daher möglich sein, die Identität der Rechtsverletzer*innen zu ermitteln, um Persönlichkeitsrechte durchzusetzen. Andernfalls verkommen diese zu einer leeren Hülle.
Wir halten die vom BMJ angedachte Ausweitung der Auskunftsansprüche auf gewerbliche Schutzrechte, z. B. Marken-, Urheberrechte oder die besagten Restaurantkritiken, für zu weitgehend. Wir sprechen uns dafür aus, den Auskunftsanspruch auf die Verletzung von Persönlichkeitsrechten zu beschränken. Hierdurch wäre sichergestellt, dass vor allem Einzelpersonen, deren Rechte durch Beleidigungen, Bedrohungen oder Verbreitung von Bildmaterial verletzt werden, profitieren und der Anspruch nicht auf alle möglichen Rechtsverletzungen ausgeweitet wird. Sollte sich das BMJ stattdessen für einen Katalog von Straftaten entscheiden, muss dieser in anderen Aspekten weiter sein als der aktuelle. Der neue Katalog sollte beispielsweise auch Bildrechtsverletzungen durch die Verbreitung von bildbasierter sexualisierter Gewalt umfassen.
Wir betrachten Urheberrechtsverletzungen nicht als digitale Gewalt. Es besteht daher kein Anlass, diese ins Gesetz gegen digitale Gewalt aufzunehmen.
Gegen digitale Straftaten in einem zivilrechtlichen Verfahren vor Gericht zu gehen, bedeutet für Betroffene nicht nur Verfahrenslaufzeiten von mehreren Monaten oder ungewisse Erfolgsaussichten. Auch hohe Kosten sind eine Hürde für die Betroffenen.
Während ein zivilrechtliches Vorgehen gegen Täter*innen allzu häufig daran scheitert, dass diese nicht identifiziert werden können, schrecken Nutzende vor einer Inanspruchnahme der Plattformen vor allem wegen der Kosten und ungleichen Machtverhältnisse zurück. Das Kostenrisiko in einem solchen Verfahren ist relativ hoch. Das liegt vor allem an den unverhältnismäßig hohen Gegenstandswerten, die bei solchen Verfahren zwischen 5000 und 10.000 Euro pro Äußerung liegen können. Je höher dieser Wert, desto höher sind auch die Gebühren für die Tätigkeit von Anwält*innen. Das heißt, auch wenn keine zusätzlichen Gerichtskosten anfallen, können Kosten von bis zu mehreren tausend Euro entstehen.
Zwar kann entgegnet werden, dass bei vollem Obsiegen ein Erstattungsanspruch gegen die Gegenseite besteht (§ 91 Abs. 1 S. 1 ZPO). Doch abgesehen davon, dass Betroffene diese Kosten teilweise vorstrecken müssen, bleibt dies oft nur Theorie. Denn selbst wenn Betroffene das Verfahren zu 100 % gewinnen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das Urteil gegen die Täter*innen nicht vollstreckt werden kann. Entweder haben diese kein oder zu wenig Geld, weswegen sie die Summen in Raten über lange Zeiträume abzahlen. In der HateAid-Prozesskostenfinanzierung betrifft dies ca. 75 % der Fälle.
Aus diesen Gründen ist es sehr wichtig, dass die Kosten für ein Gerichtsverfahren endlich gesenkt werden.
Die Förderung des BMJ beträgt nur ca. 10 % unserer Einnahmen (Zahlen für das Jahr 2024). Das Geld finanziert einen großen Teil unserer Betroffenenberatung und die Aufklärung zu neuen Phänomenbereichen digitaler Gewalt. Unsere Prozesskostenfinanzierung, mit der wir Betroffenen eine Rechtsdurchsetzung ohne eigenes Kostenrisiko ermöglichen, erhält keinerlei öffentliche Gelder. Auch unsere politische Arbeit wird nicht öffentlich gefördert.
Wir sind parteipolitisch unabhängig und handeln stets im Interesse der Betroffenen von digitaler Gewalt, mit jenem Ansatz, den wir dafür am zielführendsten halten. Hierbei schöpfen wir aus den Erfahrungen in der Beratung, der Unterstützung von mehr als 200 Einzelpersonen bei der Rechtsdurchsetzung und dem Austausch mit Expert*innen und Vertreter*innen der Zivilgesellschaft.
Als registrierte Interessensvertreterin gegenüber dem Deutschen Bundestag und der Bundesregierung trifft sich HateAid, so wie viele andere zivilrechtliche Akteure, mit Repräsentanten dieser Organe und bringt eigene Vorschläge mit ein.