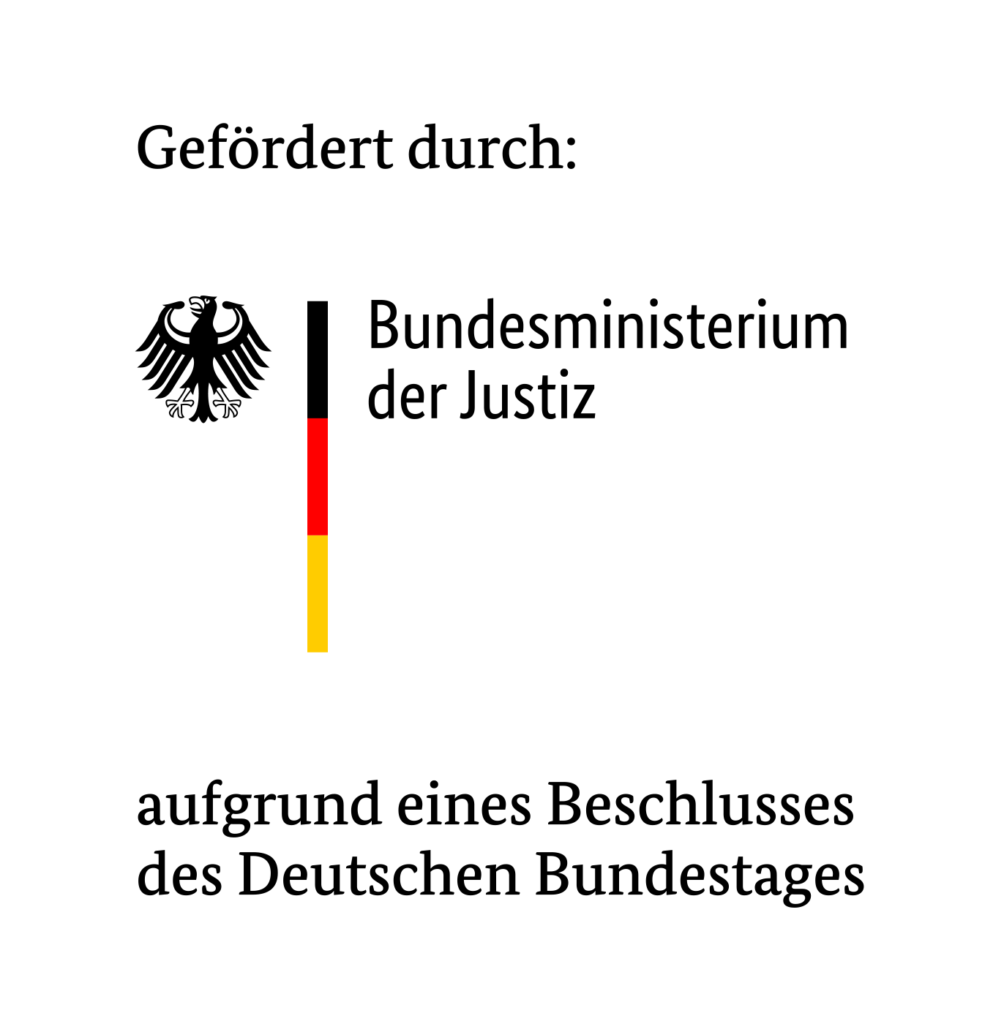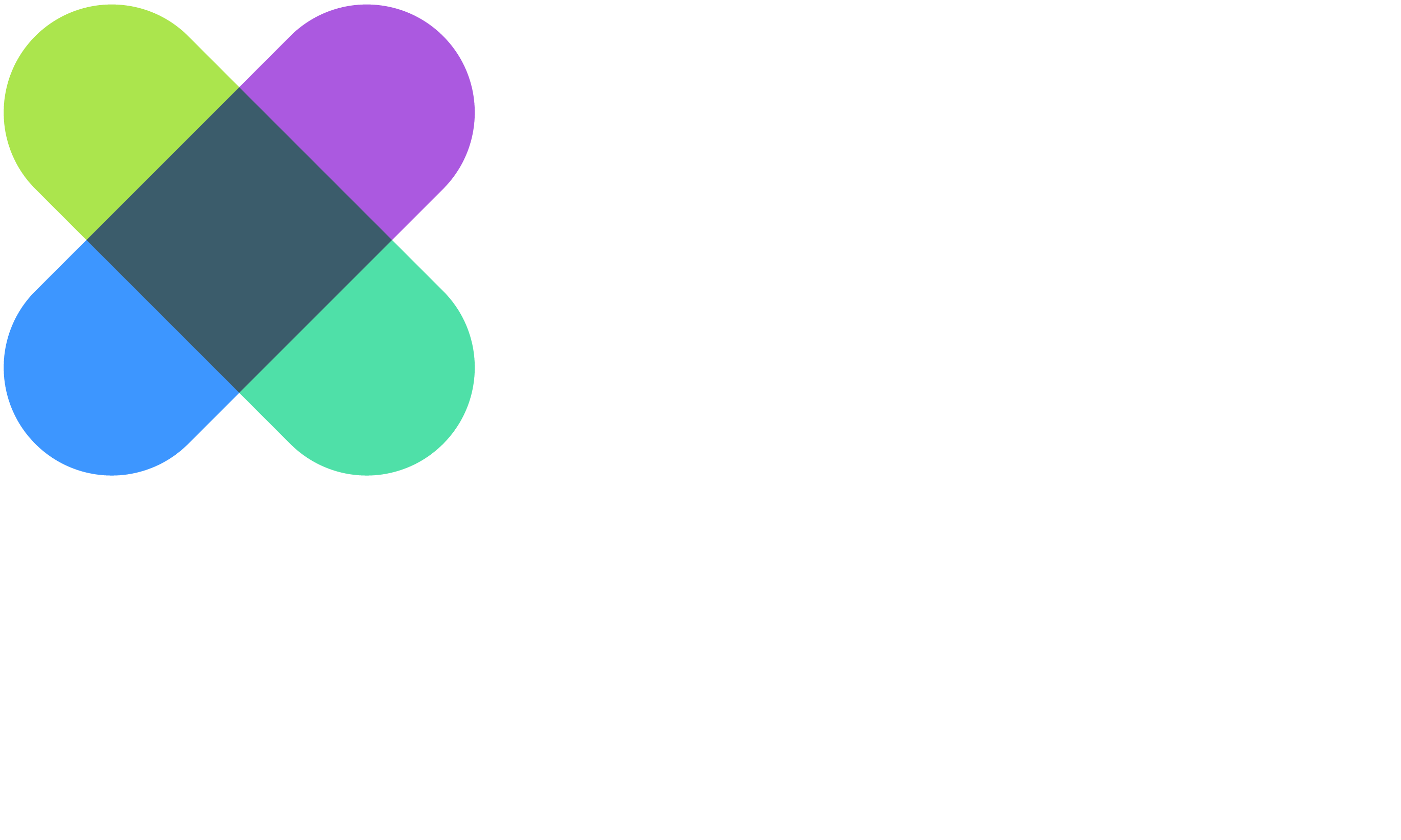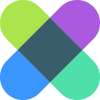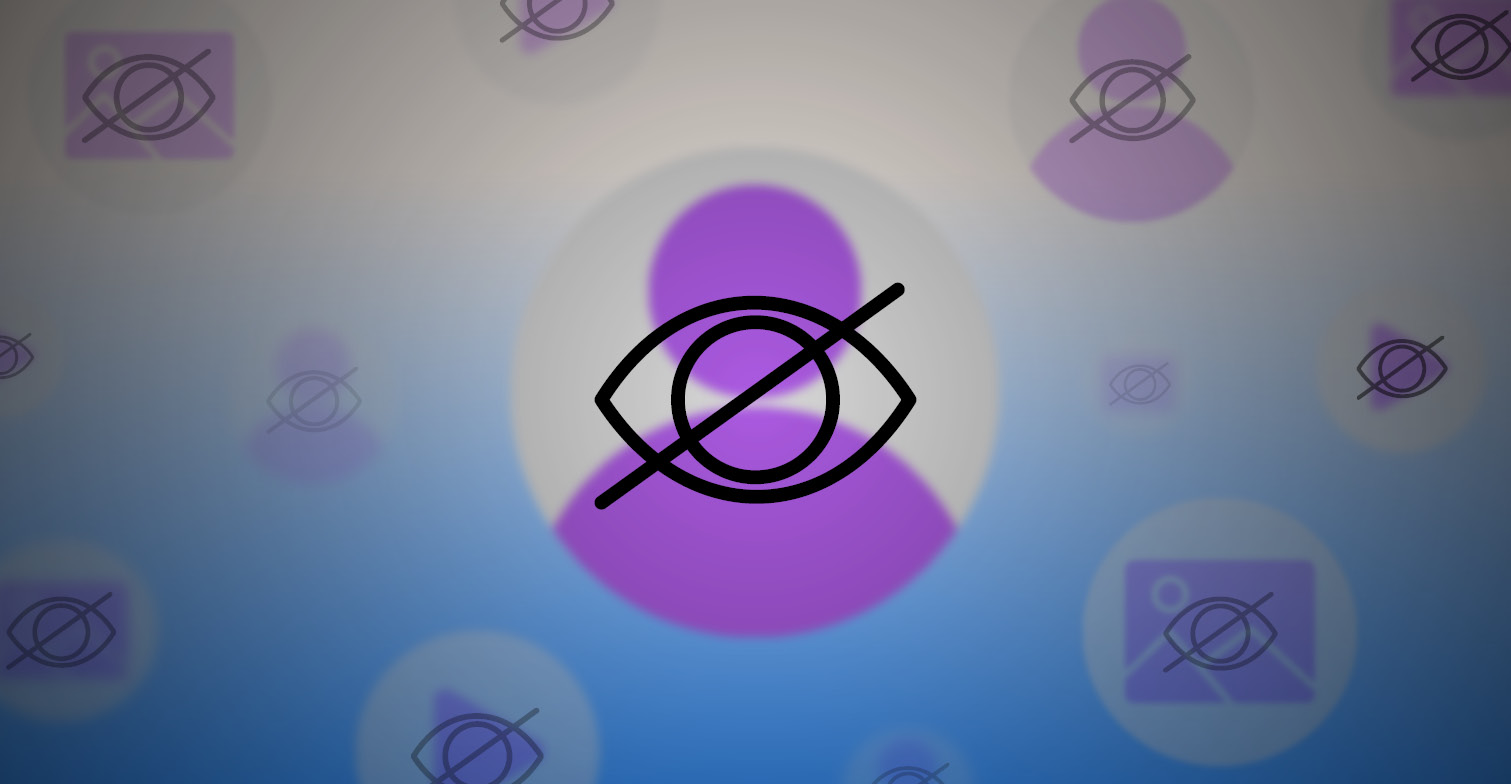Virtuelle Netzwerke, reale Morde: Attentat vom OEZ München
Can Leyla hatte immer ein Lächeln im Gesicht. Seine Augen leuchteten, wenn er von seinem Traum sprach: Fußballprofi werden. Er liebte Spieleabende mit der Familie. So erinnern sich seine Eltern, Sibel und Hasan Leyla, und sein Bruder Ferit an ihn.
Can war eines der neun Opfer des rechtsextremen Anschlags im Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) in München am 22. Juli 2016. An diesem Tag war er mit seinem Freund Selçuk Kılıç im OEZ. Sie saßen in einer Gruppe bei McDonald’s, als der Täter aus der Toilette kam und schoss.
Der Anschlag vom OEZ München zählt zu den blutigsten rassistisch motivierten Terrorakten in Deutschland. Neun Menschen starben, acht davon waren Teenager*innen.
Der Täter hielt alle von ihnen für Migrant*innen. Auch die Wahl des OEZ war kein Zufall. Der Betonbau aus dem Jahr 1972 im Münchner Stadtteil Moosach galt als Ort der Vielfalt.
Steam: Er hat sich völlig unbeobachtet radikalisiert
Der Täter war getrieben von antimuslimischem Rassismus. Radikalisiert hat er sich im Netz. Nicht irgendwo in den Schattenwelten des Internets. Sondern sichtbar für alle, auf der Gaming-Plattform Steam.
Dort hetzte er offen gegen vermeintliche muslimische Migrant*innen. Er bewunderte den norwegischen Attentäter Anders Bering Breivik, der 2011 in seinem Manifest forderte, muslimische Menschen in Europa zu vernichten.
Der Münchner Täter wählte den Jahrestag des Anschlags von Utoya und Oslo für seine Tat und kaufte im Darkweb die gleiche Waffe wie Breivik.
Nicht nur der Münchner Täter hatte Verbindungen zur Gaming-Welt. Der antisemitische und rassistische Täter von Halle streamte seinen Anschlag 2019 auf Twitch live.
Viele User*innen auf Steam feierten auch den antimuslimisch rassistischen Terroristen von Christchurch, der 2019 eine Moschee attackierte und 51 Menschen ermordete.
„Wir haben in diesen sechs Jahren um Gerechtigkeit gekämpft, uns abgemüht und gequält, aufgeschrien, gegen alle Widerstände, während die Beteiligten an diesem Attentat weiterhin ungestört und ungehindert da draußen ihr Unwesen treiben, weiter aktiv in ihrem Nazi-Netzwerk sind.”
– Sibel Leyla in einer Rede zum Jahrestag des Anschlags im Jahr 2022
Viele harmlose Gamer*innen, einige potenzielle Massenmörder?
Florian Hartleb, Politologe und Gutachter des Anschlags vom OEZ München, schlussfolgerte später: „Wir müssen schauen, ob es sich hier nicht um ein virtuelles Netzwerk potenzieller Massenmörder handelt.”
Steam, die Plattform also, auf der sich auch der Attentäter von München radikalisiert hat, ist der größte Online-Shop für Games weltweit. Spiele, deren Betreiber*innen keine eigene Plattform installiert haben, können nur über Steam installiert werden.
Täglich nutzen weltweit etwa 33 Millionen User*innen die Plattform. Die meisten von ihnen wollen einfach zocken, neue Games entdecken, soziale Kontakte pflegen.
Gaming: Nicht nur Spaß
Doch dann gibt es solche User*innen wie den Attentäter von München. Rechtsextreme, die sich in Gruppen auf Steam vernetzen und andere rechte Attentäter bejubeln.
Matthias Heider forscht am Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft zu rechtsextremer Kommunikation im Netz und Gaming Culture. Er sagt: „Gaming spielt für junge Menschen, die sich radikalisieren, eine große Rolle. Insbesondere für junge Männer.”

Prototyp: Weißer, heterosexueller Mann?
Warum? Erstens verbinden viele Gaming mit einer bestimmten Männlichkeit. Der typische Gamer war lange Zeit der weiße, heterosexuelle Mann.
Das hat sich längst geändert, Gaming wird immer vielfältiger. Rechtsextreme reagieren darauf mit Verbotstheorien: „Sie nehmen uns unsere Jobs und Frauen weg“ wird zu „Bald verbieten sie uns das Gaming.“
Außerdem gibt es wenig Kontrolle auf Gaming-Plattformen. „Jugendliche werden oft mit rechtsextremen Ideen konfrontiert,, doch bei Polizei und Behörden fehlt es am nötigen Wissen, um sich angemessen darum zu kümmern“, sagt Heider.
Das war lange ein Tabu-Thema. „Auch, weil man lange das veraltete Bild des einsamen Gamers im Keller im Kopf hatte.”
Der Terrorist vom OEZ München war neun Jahre alt, als er sich zum ersten Mal auf Steam anmeldete. Kurz nach seiner Tat sammelten sich auf seinem Profil zahlreiche Fan-Postings. „He did it. Neo Ger fucking did it”, hieß es dort etwa.
Neo Ger war zeitweise der Username des Attentäters. Die Ermordeten bezeichnete ein anderer User, ebenfalls auf dem Profil des Attentäters, als „mudslimes”. Dabei handelt es sich um einen antimuslimisch rassistischen Code aus rechtsextremen Online-Communities, der genutzt wird, um Muslim*innen zu entmenschlichen.
„Er sagte immer: ‚Mama, können wir heute einen Familienabend machen?‛ Sein Lieblingsspiel war Monopoly. Wenn er spielen wollte, lehnten wir nie ab und spielten immer mit ihm. Seit jenem tag haben wir nie wieder ein Spiel gespielt und mit seinem Fortgehen verwandelten sich diese Familienabende in eine reale und endlose Dunkelheit.”
– Sibel, Hasan und Ferit Leyla im Heft Tell Their Stories zum Gedenken an die Ermordeten
„Rechtsextreme nutzen diese Online-Sprache, um das, was als ‚normal‛ gilt, immer weiter nach rechts verschieben zu können. Häufig unter dem Deckmantel des Humors”, erklärt Heider.
Genau so funktioniere eine schleichende Radikalisierung. User*innen sähen derartige Äußerungen so oft, dass sie ihnen irgendwann normal vorkämen.
Fan-Communitys für Attentäter
Der Terrorist vom OEZ München war in zahlreichen Gruppen unter verschiedenen Namen unterwegs. Eine dieser Gruppen hieß „Anti-Refugee-Club”. Ein US-amerikanischer User, Betreiber dieser Gruppe, verfasste nach der Tat eine Fanpage für den Terroristen.
Darauf teilte er Details der Tat und versah sie mit einer Punktebewertung. Wie im Spiel. Ein Jahr später griff dieser User an einer High School in New Mexico selbst zur Waffe. Er ermordete zwei hispano-amerikanische Jugendliche.
Steam, so wie die meisten Online-Plattformen, kommt aus den USA. Die dortige Regierung unter US-Präsident Donald Trump spricht sich schon seit Amtsantritt im Januar 2025 gegen Fact-Checking und für weniger Kontrolle für Plattformen aus.
Meta hat schon zu Jahresbeginn 2025 angekündigt, seine Arbeit mit externen Fact-Checking-Partner*innen einzustellen. „Diese Entwicklungen spielen auch für das Gaming eine wichtige Rolle”, sagt Matthias Heider. „Die Debatten über den vermeintlich schädlichen Einfluss von Vielfalt und ‚Wokeness‘ gewinnen an Aufwind.”
Steam hat zwar ohnehin keine unabhängigen Fact-Checking-Programme. Dennoch wirken sich die politischen Entwicklungen in den USA auch auf die Plattform aus.
Der Hass darf nicht gewinnen
Die politische Richtung ist klar: weniger Moderation, lockere Regeln. Auch, wenn es um rassistische Inhalte geht. Das führt dazu, dass immer mehr Verantwortung bei den User*innen liegt. Und, dass immer mehr junge Menschen sich völlig ungehindert radikalisieren können.
Der Digital Services Act (DSA), das EU-weite Grundgesetz des Internet, muss auch für die Gaming-Welt gelten. Fest steht: Gaming ist längst divers. Immer mehr Spiele setzen sich mit vielfältigen Identitäten, mit Queerness oder Migrationserfahrungen auseinander.
Es braucht wirksame Kontrolle, um sie zu schützen. Und um zu verhindern, dass die rassistischen Attentäter*innen von morgen im Netz in ihrem Hass bestärkt werden. Die Behörden müssen endlich handeln.
„Den Rassist*innen sage ich: Es wird schwierig sein, mit euch zusammenzuleben, in diesem Land, in dem etwas in Unordnung geraten ist. Aber wir sind hier. Ich bin davon überzeugt, dass es Tausende von Menschen gibt, die dieselbe Einstellung haben wie ich. Es gibt für uns kein Land, für das wir kämpfen. Unser Land ist die Welt.”
– Sibel Leyla in einem Gastbeitrag für die FAZ 2020