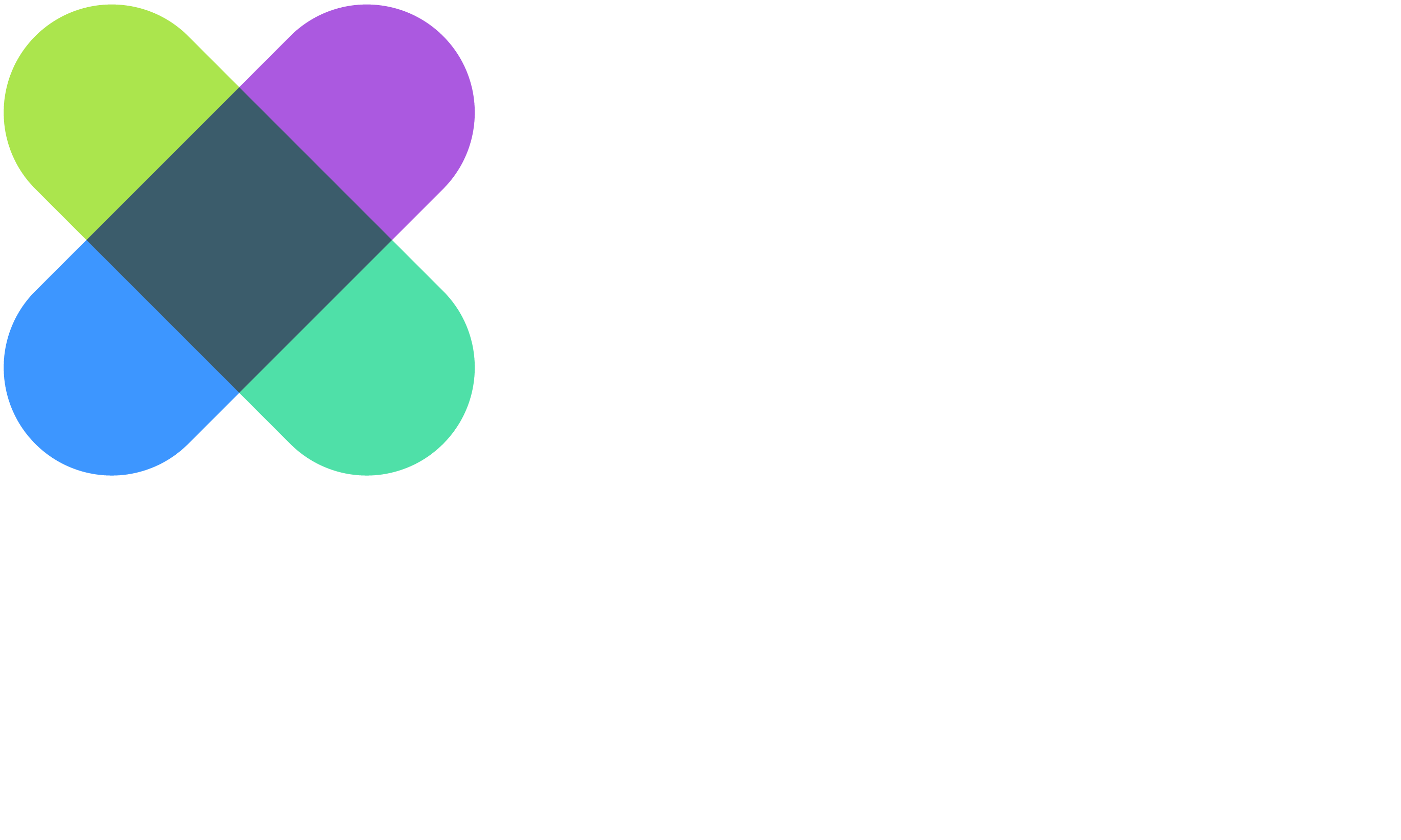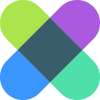Laut und bunt für LGBTQIA+: Im Interview mit „Obertunte” Jona Oremek
Jona, sowohl analog auf Demonstrationen als auch digital z. B. auf Instagram bist du aktivistisch und leistest dort viel Aufklärungsarbeit. Wie kam es dazu – und warum das alles als „Obertunte”?
Jona: Als ich mich mit 13 geoutet habe und mit queeren Personen vernetzt habe, dachte ich:
Jetzt bin ich angekommen. Jetzt werde ich akzeptiert. Schnell musste ich lernen, dass ich auch in der eigenen Community ausgegrenzt werde. Zu tuntig, zu bunt, zu laut, zu politisch.
Da dachte ich mir: „Verdammt! Ich bin die Randgruppe innerhalb der Randgruppe.“ Bis ich dann schnell gelernt habe, dass das ein Problem der anderen ist. Wenn es so schlimm ist, dass ich eine Tunte bin, dann bin ich eben die Obertunte! Und als diese organisiere ich CSDs, Shows und trete mit der Politik in Kontakt, gehe in die Gemeinderäte zur Bürger*innenfragerunde und versuche, die queere Community, wo es auch geht, sichtbar zu machen.
Worüber klärst du auf, was sind deine Hauptthemen und was ist dir dabei wichtig?

Jona: Den meisten Personen ist gar nicht bewusst, dass queere Personen strukturell und staatlich sowie auch im Alltag massiver Diskriminierung ausgesetzt sind. Besonders in der Schule war ich von Diskriminierung sowohl aufgrund meiner geschlechtlichen Identität als auch meiner sexuellen Orientierung betroffen.
Eine Lehrkraft hat sich in der 8. Klasse bei uns homofeindlich mit der Ansicht geäußert, dass Homosexualität sündhaft sei und von Gott bestraft werden würde.
Als ich innerhalb eines Internetauftritts zum IDAHOBIT (International Day Against Homo-, Bi-, Trans- and Interphobia) mich dazu und der alltäglichen Diskriminierung von Schüler*innen anonymisiert geäußert hatte, hat meine Schule mir mit einer Anzeige wegen Verleumdung gedroht.
Queere Jugendliche sind an Schulen, an denen Lehrkräfte nicht ausreichend ausgebildet sind und Aufklärung über sexuelle und geschlechtliche Vielfalt freiwillig und nicht staatlich verpflichtet ist und unterstützt wird, hilflos und eindeutig besonders vulnerabel.
Mein Aktivismus besteht darin, die Dinge auszusprechen wie sie sind:
Wie die Polizei mich für meine Diskriminierungserfahrungen verantwortlich macht, weil ich damit rechnen müsse, wenn ich mich „so gebe”, wie Lehrkräfte und Schulen konsequent Diskriminierungserfahrungen ignorieren, wie Ordnungsämter einem bei der Anmeldung einer Demo Steine in den Weg legen, wie man Morddrohungen über Instagram bekommt, weil man einen CSD organisiert, was auf der Straße tagtäglich passiert und wie man im öffentlichen Leben und staatlich, bspw. durch das TSG oder Abstammungsgesetz diskriminiert wird …
Wie kam es dazu, dass du Instagram als Sprachrohr nutzt?
Jona: Als ich mir Tunte als positive Selbstbezeichnung angeeignet habe, war klar, dass ich meinen Instagram-Namen auch umändern würde. Vor zehn Jahren haben die meisten über Facebook politische Aktionen geteilt, mittlerweile geht viel auch über Instagram.
Ein Bild von mir im Fummel mit ’nem Demo-Schild, das für den CSD Friedrichshafen am 22.07. wirbt, kriegt natürlich mehr Aufmerksamkeit als ein olles Sharepic.
Wenn ich einen Redebeitrag auf einer Demo oder im Gemeinderat halte und dieser gefilmt wurde, ist er auf Instagram auf jeden Fall besser als auf meinem Archiv aufgehoben. Ich möchte Leute empowern und sichtbar machen, das geht darüber gut.
Widerfährt mir Diskriminierung, dann möchte ich diesen untragbaren Zustand teilen, mit Personen in einen Austausch kommen und einfach meine Existenz sichtbar wissen.
Ich wollte, dass wer auch immer meinen Instagram-Account entdecken würde, eine kompromisslose queere Person sehen würde, ich muss mich nicht für mich entschuldigen. In die Heteronorm passe ich nicht, will ich nicht und muss ich nicht.
Wir existieren und das ist auch gut so! Eine nichtbinäre, trans feminine, Sex positive Punk-Tunte hat genau so ihre Daseinsberechtigung wie das lesbische Ehepaar mit Kindern auf’m Dorf.
Als nicht genderkonforme Person merke ich, wie man sich über mich aufregt, weil ich ein „Stereotyp” darstellen würde. Dabei bin meistens ich die Person, die ihren Mund aufbekommt, weil ich aus der Not heraus agiere und besonders betroffen bin.
Das ist heute so, das war damals so. Nichts anderes war es bei Stonewall.
Erlebst du auf Instagram eine Community und wenn ja, was bedeutet sie für dich und andere?
Jona: Über Insta-Posts können wir mega viel über uns lernen, Ressourcen teilen, uns vernetzen oder Solidarität zeigen. Ich kann bspw. sehen, ob eine Person ihre Pronomen auf ihrem Profil angegeben hat oder nicht. Pronomen können nämlich keinem Menschen angesehen werden. Per Insta konnte ich auch schon Leute von CSDs wiederentdecken und mich vernetzen, obwohl ich mich auf der Demo selbst vielleicht nicht getraut habe, sie anzusprechen. Dadurch konnten schon jahrelange Freund*innenschaften entstehen.
Wie wichtig ist der digitale Raum für die queere Community?
Jona: Der digitale Raum ist genauso wichtig für die queere Community, wie für jede andere Gruppe, die sich organisieren will. Als wir 2021 den ersten Queer Pride in Ravensburg als Gegenreaktion zu abgerissenen Regenbogenstreifen organisiert haben, ging das nur, weil wir uns über Messenger-Gruppen organisieren konnten.
Erlebst du selbst digitale Gewalt? Wenn ja, wie gehst du damit um?
Jona: Von beleidigenden Hassnachrichten, Menschen, die mir schreiben, dass ich ins Konzentrationslager gehöre oder Personen, die mir direkt mit Mord drohen, gibt und gab es alles. Deswegen nutze ich mittlerweile unter anderem Wortfilter, die in den Plattform-Einstellungen angelegt werden können.
Als die ersten solcher Nachrichten kamen, muss ich 15 gewesen sein, da ging’s mir natürlich richtig beschissen. Zum Glück hatte ich ein stabiles Umfeld, das mich auffangen konnte. Schnell habe ich dann gelernt, dass es gar nicht um mich geht. Mein Queersein reicht aus. Meine Queerness ist dann quasi eine „politische Position”.
Menschenrechte werden verhandelbar. Menschenrechte sind provokant.
Bei der Polizeiwache wurde ich abgewiesen. Mir wurde erklärt, dass ich doch damit rechnen müsse, wenn ich mich so im Internet geben würde. Das war’s dann auch.
HateAid hat mir schon unfassbar viel Arbeit abnehmen können und ich bin dankbar für dieses definitiv notwendige und wichtige Angebot.
Überwiegt das Negative oder das Positive in deinem digitalen Umfeld?
Jona: Es ist natürlich total ambivalent. Durch die Vernetzung und Sichtbarmachung queeren Lebens überwiegt für mich grundsätzlich das Gute. So viele junge Personen, so viele vulnerable Menschen können aufgeklärt werden und ihnen das Verständnis vermittelt werden, dass sie nicht falsch sind.
Wenn du aber einmal falsch abbiegst, kommst du an irgendwelche toxischen Andrew Tates ran. Davon unabhängig ist für mich aber auf jeden Fall klar, dass das Internet leider tatsächlich zu oft ein rechtsfreier Raum ist. Es braucht mehr Fortbildungen für Polizist*innen. Es gäbe so viel Handlungsraum für die Politik …
Was motiviert dich, im digitalen Raum präsent zu bleiben?
Jona: Jede Person, die sich durch unsere reine Existenz und politische Arbeit ermutigt fühlt, zu sich selbst zu stehen. Jede Person, die ihre Ketten der Heteronorm abwirft und zu sich selbst steht. Jedes verletzte Kind, das einen Schritt weiter auf dem Weg zur Heilung gekommen ist. Jede Person, die sieht: Ja ich bin nicht alleine. Die Einsamkeit hat ein Ende. Ich bin nicht falsch.
Empowerment ist ein wichtiges queer-feministisches Thema, auch im digitalen Raum: Was bedeutet es für dich?
Jona: „Nicht Unterschiede lähmen uns, sondern Schweigen” – Audre Lorde
Intersektionalität muss ein politisches Selbstverständnis sein und darf nicht zur Außendarstellung ausgenutzt werden.
Empowerment bedeutet Feiern, Weiterbilden, Sichtbarkeit, Mitgefühl und politisches Handeln für alle nach den Bedürfnissen aller.
Hast du ein „schönstes Erlebnis” von deiner Arbeit auf Instagram?
Jona: Manchmal schreiben mir Leute, die mal einen Artikel über mich oder einen Redebeitrag von mir gesehen haben. Es gibt nichts Schöneres, als von einer Person zu hören, dass du der Grund dafür bist, warum die Person sich nicht mehr alleine fühlt und sich endlich traut, zu sich selbst zu stehen. Manchmal fragen Leute nach Tipps oder möchten einfach nur Danke sagen. Jede Person, die ihre Ketten endlich abwirft, ist ein Geschenk.
Hast du etwas, was du uns und unseren Leser*innen sowie der queeren Community mitgeben möchtest?
Jona:
Unauffällig queer sein geht nur, weil Auffällige kämpfen.
Schafft das TSG ab, reformiert das Abstammungsgesetz, verbietet sogenannte Konversionsbehandlungen, klärt an Schulen auf. Wir dürfen Jugendliche nicht alleine lassen.
Solidarität Zeigen kann schon klein anfangen: Bei der nächsten Vorstellungsrunde könntest du dich ja mit deinen Pronomen, wie du angesprochen werden möchtest, vorstellen!
Aber vor allem: Du musst meine Existenz nicht verstehen, um mich zu respektieren.
Titelbild: Claudia Casagrand